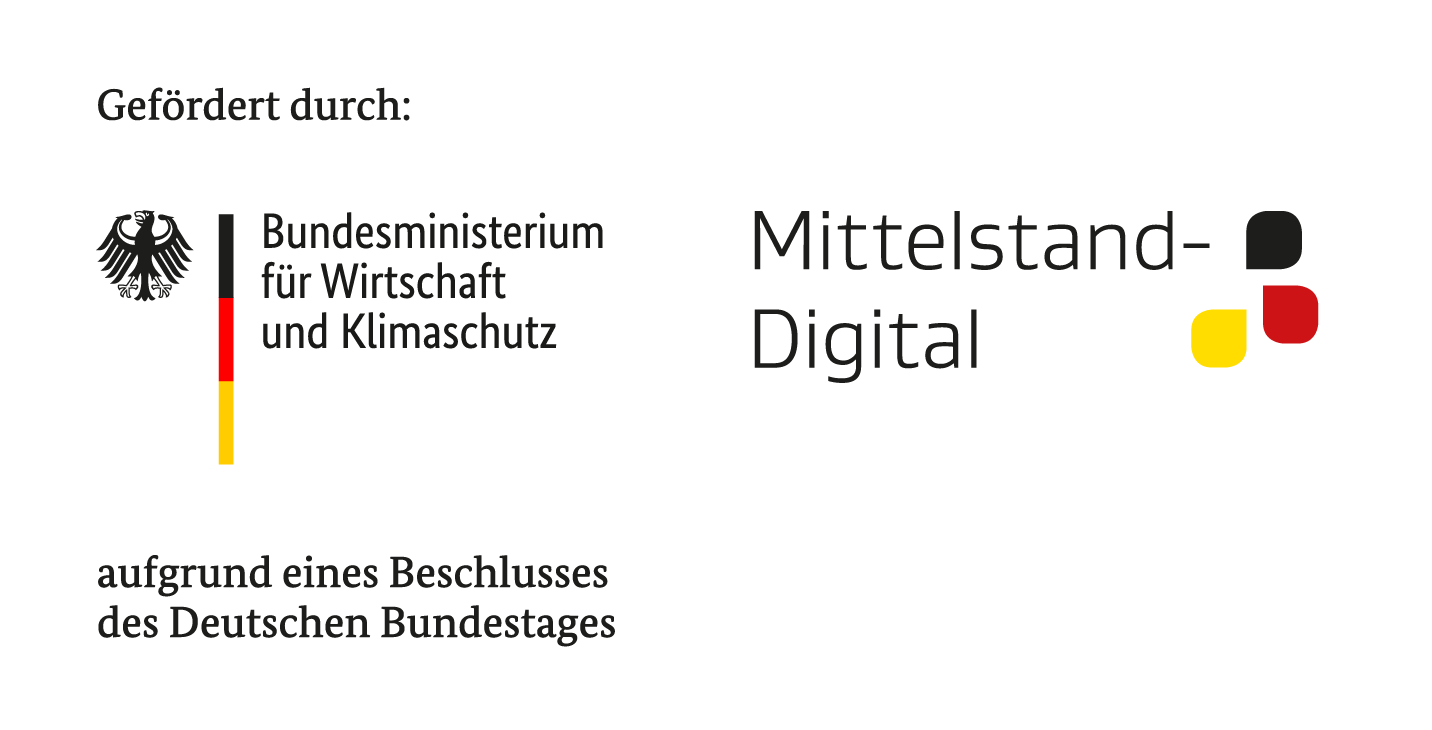Der hier bereitgestellte ESG-Check soll Unternehmen dabei unterstützen, sich in wichtigen Geschäftsprozessen zu den Fragen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und Transparenz zu positionieren und darauf aufbauend individuelle Roadmaps zur Verbesserung auszuarbeiten.
Zunächst wichtige Begriffsklärungen
ESG – Environmental, Social and Corporate Governance werden als die zentralen neuen Unternehmenswerte identifiziert, die uns als Gesellschaft und Wirtschaft in eine nachhaltige und faire Zukunft führen sollen (https://de.wikipedia.org/wiki/Environmental,_Social_and_Governance). Dabei fokussieren sich die meisten konkreten Anpassungsbedarfe vor allem auf das „E“ also auf gut quantifizierbare Auswirkungen des unternehmerischen Handelns und der erzeugten Produkte auf die Umwelt. Unter dem „S“ subsumiert man viele der auch durch die „SDG“ also die „Sustainable Development Golas“ definierten ethischen und sozialen Grundsätze einer globalen nachhaltigen Entwicklung unter Ausschluss diskriminierender oder ausbeuterischer Handlungsweisen an Mensch und Natur (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174) . „Governance“ bedeutet vor allem eine transparente und ehrliche Arbeits- und Kooperationsweise und zielt daher stark auf das erforderliche Reporting ab. Ein zukünftig wertvolles Unternehmen sollte also nachhaltig, sozial und ehrlich agieren. Dafür entwickelt man Messinstrumente und fordert Information wie z.B. in Form der Nachhaltigkeitsberichte.
EU-Taxonomie - Die EU-Taxonomie-Verordnung, richtigerweise die VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0852) wird oft mit dem Thema ESG gleichgesetzt beschreibt jedoch die regulatorische Festsetzung erforderlicher, zu bewertender und nachzuweisender Maßnahmen und Verfahren zur Förderung und Einhaltung nachhaltiger Finanzierungsmodelle im Sinne des European Green Deals. Konkretisiert werden die Anforderungen in Form sogenannter „delegierter Rechtsakte“. Im Kontext der Einhaltung der Anforderungen aus der Taxonomie-VO spricht man meist von EU-Taxonomie- oder auch ESG-Konformität. Aufgrund der Tatsache, dass die Ausarbeitung der „Delegierten Rechtsakte“ noch nicht umfassend und abgeschlossen und auch viele Taxonomie-Verfahren zur Bestimmung und Differenzierung der betreffenden Umweltwirkungen und Nachhaltigkeitsfaktoren noch nicht harmonisiert sind, ist die Anwendung der Taxonomie-VO noch mit prozessbelastenden Unsicherheiten verbunden.
Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) -Wie oben dargestellt wirkt sich die Taxonomie-Verordnung gleichzeitig auch auf die Offenlegungsverordnung ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R2088 ) der EU aus, welche die Veröffentlichung von Informationen der Finanzmarktteilnehmer zur Nachhaltigkeit ihrer Investitionsentscheidungen regelt und fordert. Mit der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) vom 18. Juni 2020 wurde das Klassifikationssystem (Taxonomie) zur Beurteilung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten in die Offenlegungs-VO integriert. Das bedeutet, dass zukünftig Banken, die in Immobilienfinanzierungen oder -transaktionen involviert sind, zur Offenlegung betreffender umweltbezogener Qualitäten verpflichtet sind. Hintergrund hierzu ist die von der Europäischen Zentralbank (EZB) bzw. der Bankenaufsicht (Bafin) adressierte Tatsache, dass umweltrelevante Qualitätsfaktoren wie die Energieeffizienz, zukünftig aber auch eine positive Ökobilanz, eine möglichst positive Wirkung auf die Umgebung und den Wasserhaushalt, die Kreislauffähigkeit oder den Einfluss auf die Biodiversität wichtige Bestandteile eines Immobilienwertes darstellen und deshalb zwingend in die Risikoermittlung und Kreditvergabe einer Investitionsmaßnahme aufzunehmen sind. Dies gilt nachvollziehbar nicht ausschließlich aber im besonderen Maße auch für Wohn- und Nichtwohngebäude und damit für die gesamte Bau- und Immobilienbranche.
Im ersten Schritt hat diese Neuregulierung dazu geführt, dass anhand der neuen Offenlegungsverordnung zum 01.01.2023 alle von den Banken finanzierten, mitfinanzierten oder im Handel befindlichen Bauobjekte hinsichtlich des energetischen Standards mit Buchstabenklassen A-H, wie man sie vom Kühlschrank kennt, an die EZB zu melden sind. Dies wiederum hat große Verunsicherung in der Vorgehensweise zur Bestimmung dieser Buchstabenklassen ausgelöst, da einerseits den Banken in sehr vielen Fällen die dafür erforderlichen Nachweise (z.B. Energiebedarfsausweise) nicht vorliegen oder aufgrund des Alters nicht existieren und man gleichzeitig normative Lücken in der Zuordnung des Energiebedarfes in kWh/m²a auf Buchstabenklassen bei Nichtwohngebäuden entdeckt hat, die eine eindeutige Klassifizierung selbst bei vorliegenden Dokumenten und Daten erschwert.
Unabhängig davon, ob nun die ein oder andere prozessuale oder normative Regelung noch geschaffen und vereinbart werden muss, resultiert daraus eine eindeutige Konsequenz:
„Wer zukünftig als Unternehmen keine Aussagen zu wichtigen ESG-Faktoren treffen und nachweisen kann, wird mit deutlichen und wachsenden Nachteilen in der Investitionsfinanzierung rechnen müssen.
Nichtwissen schützt nicht, sondern entzieht dem Unternehmen zunehmend den Zugang zu Fremdkapital.“
Dass dieser Aspekt sich im Kontext der Bau- und Immobilienwirtschaft doppelt stark auswirkt, da hier nicht nur in großem Maße die Unternehmen selbst als auch deren Produkt eines Hoch- oder Infrastrukturobjekts betroffen ist, versteht sich von selbst und macht es so wichtig, als Unternehmen frühzeitig „ESG-Ready“ zu sein.
Um die Unternehmen hier gezielt zu unterstützen, wurde vom Mittelstand Digital Zentrum Bau in Kooperation mit dem österreichischen Kompetenzzentrum Future Digital ein spezifisches Reifegradmodell zu ESG erstellt, um schnell und einfach seine eigene Ausgangsposition zu bestimmen und darauf aufbauend eine eigene individuelle Handlungs-Roadmap auszuarbeiten.
Die zugrundeliegende Methodik nutzt dabei das vom Kompetenzzentrum Future Digital (https://kompetenzzentrumfuturedigital.com/) ausgearbeitete Reifegradmodell der Digitalisierung im Bauwesen in Abwandlung auf den spezifischen Transformationsbedarf aus ESG und der EU-Taxonomie-VO.
Im Folgenden sind sowohl die betreffenden Handlungs- und Transformationsdimensionen wie auch die zugehörigen Reifegrade beschrieben und differenziert.
Das ESG-Reifegradmodell besitzt 4 Handlungsdimensionen (Produkt, Prozesse, IT-Systeme und Daten), welche sich wiederum in weitere 3 Unteraspekte aufteilen, zu denen es dann jeweils 4 zu differenzierende Reifegrade gibt.